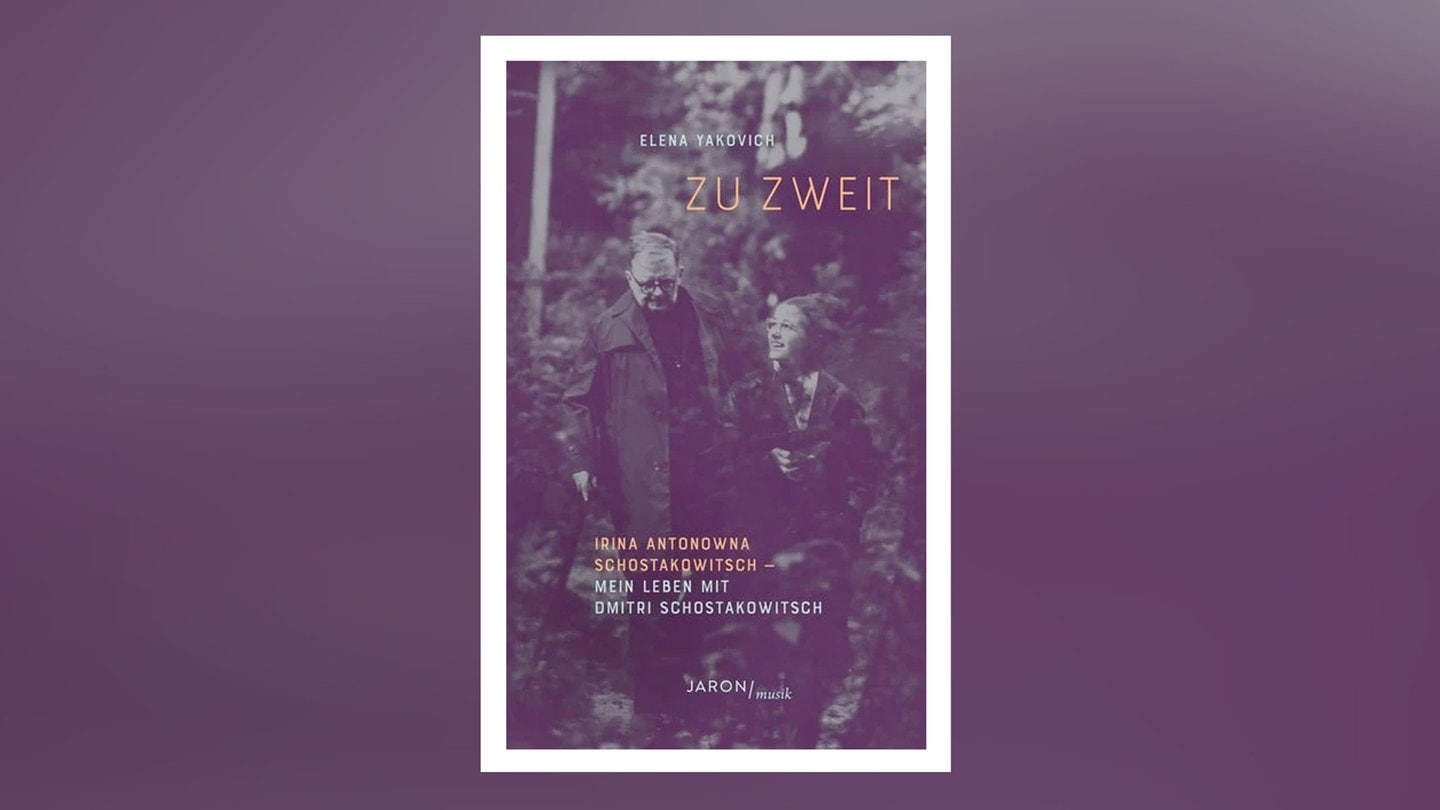Dmitri Schostakowitschs dritte Ehefrau Irina Antonowna hat ihn mittlerweile seit einem halben Jahrhundert überlebt. Sie hat einen Verlag mit seinem Namen gegründet, sein Gesamtwerk mitherausgegeben und verwaltet sein gesamtes Erbe – bis heute. Im Oktober erscheint jetzt erstmals ein Buch, in dem sie von ihrem und dem gemeinsamen Leben mit dem Komponisten berichtet.
Eigentlich hatte die Filmemacherin Elena Yakovich mit ihrem Vorhaben abgeschlossen: Schon vor Jahren wollte sie mit und über Dmitri Schostakowitschs dritte Frau, Irina Antonowna Supinskaya, eine Dokumentation drehen –Doch Irina Antonowna verweigerte zu diesem Zeitpunkt noch strikt alle Interviewanfragen:
Zitat: „Irgendwie wusste ich sofort, dass ich einen Film mit ihr machen wollte – aber sie lehnte ab. Es war zwecklos, sie überreden zu wollen, sie hat so einen selbstständigen Charakter – selten habe ich eine unabhängigere Person getroffen.“
Erst nach einigen Jahren, die die beiden in Kontakt geblieben waren, hatte Elena Yakovich aber Erfolg mit ihrer Anfrage. Ergebnis ist der Film „Zu zweit. Irina Antonowna Schostakowitsch – Mein Leben mit Dmitri Schostakowitsch“, der im März 2022 in die Kinos kam. Und jetzt das gleichnamige Buch.
Zitat: „Während große Teile unseres Gesprächs im Film nicht berücksichtigt werden konnten, enthält dieses Buch Irina Antonownas vollständigen Bericht: ihre Kindheit, Jugend und die Zeit, bevor sie Schostakowitsch kennenlernte sowie die dreizehn Jahre mit Dmitri Dmitrijewitsch. […] zum ersten Mal [spricht sie hier] in aller Ausführlichkeit über die Zeit, über sich selbst und über ihrer beider Schicksal.“
Im ersten Teil stellt Elena Yakovich den Erzählungen von Irina Antonowna kurze einordnende Episoden aus dem Leben Dmitri Schostakowitschs gegenüber – die beiden trennte ein Altersunterschied von 28 Jahren, und so erlebte Irina Antonowna natürlich eine lange Zeit ohne ihn, in der er aber bereits als Komponist bekannt war. Als Irina etwa mit sieben Jahren als Halbwaise in ein Kinderheim gebracht wird, arbeitete Dmitri gerade an seiner 7. Sinfonie; als sie in der achten Klasse ihre erste Schulfreundin findet, bereist er die USA und spielt im Saal des Madison Square Garden, unter anderem vor Albert Einstein, auf dem Klavier das Scherzo aus seiner fünften Sinfonie; Und als sie sich kennenlernen, arbeitet Irina als Redakteurin bei einem Musikverlag, der auch Dmitris Werke verlegt. Immer wieder haben die beiden lose miteinander zu tun, bis sie irgendwann direkt an einer seiner Kompositionen arbeitet:
Zitat: „Ohne einen Hintergedanken zu vermuten, rief ich bei Schostakowitsch an und sagte, dass ich zu ihm käme, um die Änderungen an [seiner Operette] ‚Moskau – Tscherjomuschki‘ mit ihm zu besprechen. […] Als ich ankam, hatte ich das seltsame Gefühl, eine schwere Last zu tragen – doch plötzlich war diese Empfindung verschwunden, es war, als ob sich etwas in meiner Seele gelöst hätte. Er war ein sehr feinsinniger Mensch.“
Das Buch gibt Irina Antonownas detaillierte Erzählung auf rund 150 Seiten direkt wieder: Wie sie und Dmitri begannen sich vorsichtig zu treffen und zu unterhalten, wie sie immer mehr Gemeinsamkeiten entdeckten und sich vertrauter wurden:
Zitat: „Schon bald nannte ich ihn ‚Mitja‘, und wir begannen einander zu duzen. Vollkommen unerwartet fragte er mich dann, ob ich seine Frau werden wolle. Ich antwortete sofort, dass das überhaupt nicht in Frage käme, und ging. Er hatte Kinder in meinem Alter, was sollte ich mit ihnen anfangen? Seine Frau war vor acht Jahren verstorben – was sollte ich da?!“
Und doch, ihre Zuneigung leugnet sie nicht – nach langem Drängen und emotionalem Druck von seiner Seite entschied sich Irina schließlich doch zu bleiben[MH1] [H2] , ihn zu heiraten und mit ihm zusammen zu ziehen. Fortan begleitet sie sein Leben: Sie kommt zu so gut wie allen Veranstaltungen, Reisen und Konzerten mit, arbeitet gemeinsam mit ihm an seinen Kompositionen, unterstützt ihn in seiner politischen Arbeit, lernt seine Weggefährten kennen und begleitet ihn während seiner schweren Krankheit bis zum Tod.
Musik (Bratschensonate)
Elena Yakovich gliedert Irina Antonownas Erzählung nicht nur chronologisch, sondern auch thematisch – und ergänzt sie immer wieder durch einordnende Kapitel „aus dem Archiv der Autorin“ und kurze kontextualisierende Absätze. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn es um nicht hinreichend belegte Mythen oder historische Ereignisse geht oder um die Erzählsituation, in der Irina Antonowna bestimmte Dinge sagt.
Obwohl sie detailliert und offen über ihr gemeinsames Leben mit Dmitri Schostakowitsch berichtet und private und intime Einblicke gewährt, entsteht beim Lesen nie das Gefühl, voyeuristisch durchs Schlüsselloch zu gucken. Ihr Bericht balanciert respektvoll zwischen Erinnerungen aus ihrer eigenen Perspektive und dem Bedürfnis ihres verstorbenen Ehemanns, nicht zu viel preiszugeben von der eigenen Verletzlichkeit:
Zitat: „Eines Tages gestand ich Dmitri Dmitrijewitsch: ‚Weißt du, ich bin damals zu der Versammlung gegangen, auf der man dich zum Parteibeitritt gezwungen hat.‘ Er antwortete: ‚Wenn du mich liebst, sprichst du nicht darüber.‘ Und wir haben es nie wieder erwähnt. Er war damals in einem so schrecklichen Zustand gewesen … las murmelnd etwas von einem Papier ab … Man erzählte mir, er habe nach der Versammlung geweint.“
Elena Yakovichs Aufbereitung von Irina Antonownas Erinnerungen sind nicht nur für Kennerinnen von Dmitri Schostakowitschs Leben und Werk interessant – vor allem auch vor historischem und politischem Hintergrund liest sich Irina Antonownas Lebensbericht beinahe wie ein Tolstoi-Roman. Es ist ein großes Glück, dass Irina Antonowna Schostakowitsch sich dazu entschieden hat ihre Memoiren mit der Welt zu teilen. Denn „Zu zweit“ ist nicht nur ein wichtiges Zeitzeugnis, sondern darüber hinaus auch ein Buch, das man beim Lesen kaum mehr aus der Hand legen kann.