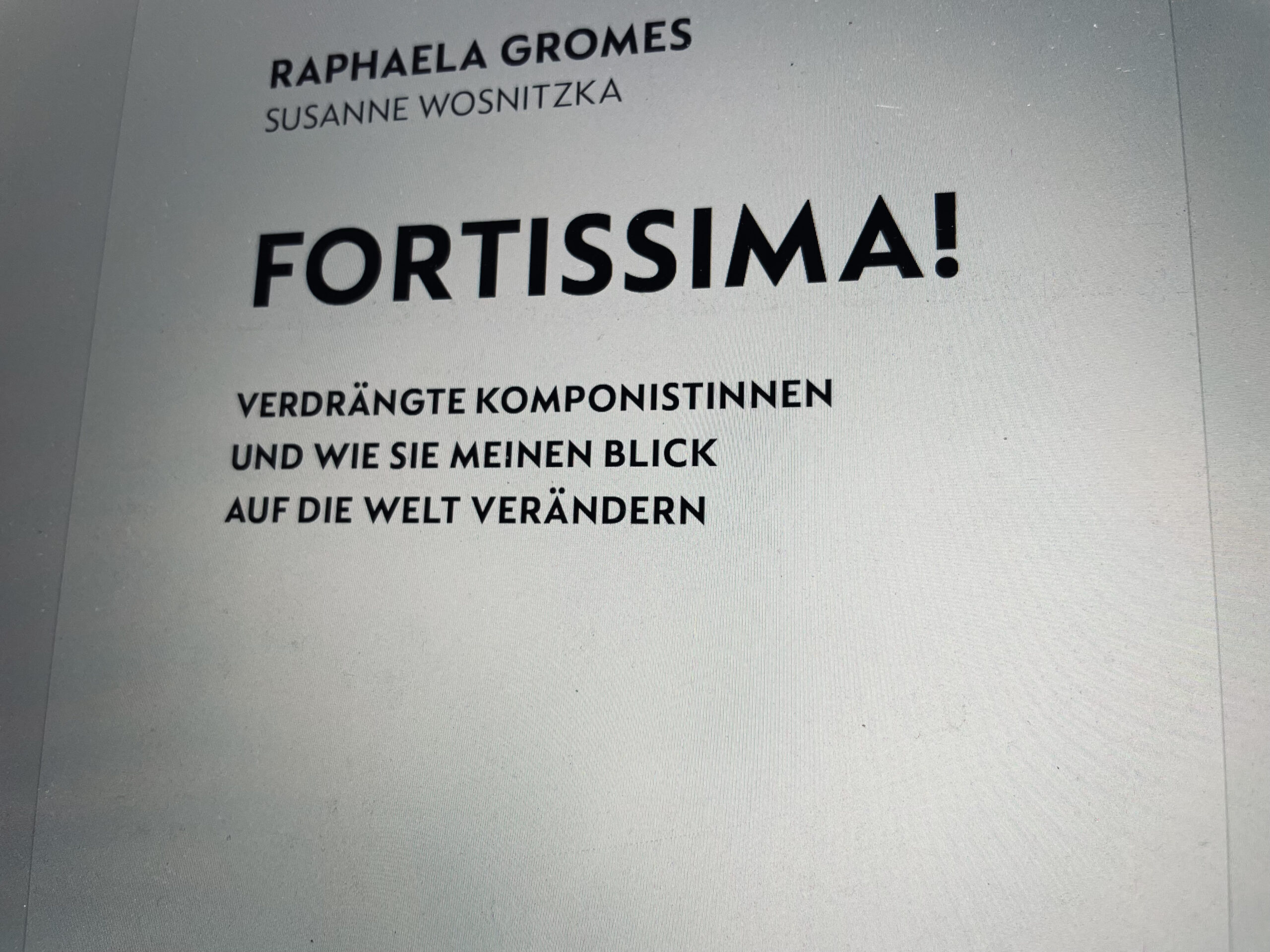Vermutlich können die meisten, die Musik oder Musikwissenschaft studiert haben, Raphaela Gromes‘ Erfahrungen teilen: Es geht in den historischen, theoretischen und praktischen Curricula stets um die gleiche Musikgeschichte – begonnen bei der Knochenflöte über die Gregorianik und Notre-Dame-Epoche zur frühen Mehrstimmigkeit, Renaissance, Barock, Klassik, Romantik, und immer stehen die gleichen Namen von männlichen Schöpfern und Genies im Zentrum. Es wirkt stets, als hätten sie allein diese ästhetische, künstlerische und wissenschaftliche Entwicklung geprägt.
Zitat: „Was ich damals nicht hinterfragt habe: All diese Genies waren Männer. Alle Werke, die wir in Museen bestaunten und in Konzerten hörten: selbstverständlich von genialen Männern geschaffen. […] In meinem Studium wurden die Leistungen von Frauen nur gestreift: In der damaligen Lehre spielten sie nur als Mütter, Schwestern, Ehefrauen oder Musen wichtiger Männer eine Rolle.“ (17)
Raphaela Gromes drängte sich im Laufe ihrer Ausbildung und Karriere die Frage auf, ob es nicht auch anders hätte gewesen sein können. „Komponistinnen, die zu ihren Lebzeiten über Landesgrenzen hinaus bekannt waren und gefeiert wurden“ gab es schließlich zuhauf – sie sind nur nach ihrem Tod völlig in Vergessenheit geraten,oder viel treffender müsste man sagen: Ihre Arbeit wurde systematisch verschwiegen, Werke wurden nicht mehr aufgeführt, ihre Namen nicht genannt, das Geschaffene sich von Männern angeeignet:
Zitat: „Nach Jahrhunderten des Schweigens und Verschweigens wurden und werden sie nach und nach wiederentdeckt. Umso erstaunlicher ist, dass die Werke dieser Frauen heute trotz rund 50 Jahren fundierter Forschung im klassischen Musikleben kaum angekommen sind.“ (17)
Raphaela Gromes formuliert in „Fortissima“ einerseits ihre persönlichen Fragen und Gedanken und ihre Geschichte und Ambition als Interpretin. Wir erfahren von ihrer frühesten Schule – bei ihrer Mutter als Lehrerin –, ersten Konzerten und Erfolgen, dem Studium, Erfahrungen mit Lehrern, auf und hinter der Bühne und in Rezensionen. Dabei stellt sie ihre Erfahrungen als Interpretin in eine Linie mit den Erfahrungen, die die Komponistinnen gemacht haben, über die sie schreibt: Misogyne Handlungen und Aussagen, die sie abwerten, einfach nur, weil sie Frauen sind – das gab es vor 300 Jahren genau wie heute.
Zitat: „Je mehr dieser Lebensgeschichten ich in den letzten Jahren las, desto betroffener wurde ich. Was diese Komponistinnen erleben und sich innerhalb eines so frauenfeindlichen Systems erkämpfen mussten, hat meinen Blick auf die Welt grundlegend verändert. Durch meine Recherchen zu Femmesund Fortissima! wurde ich zur Feministin. […] Ich [lese] Zeitungsartikel anders, höre Menschen anders zu und ordne Dinge neu ein. Meistens geht es nicht mal darum, dass etwas offen Diskriminierendes gesagt wird, sondern um die Auslassungen.“ (184)
Für diese Einordnungen arbeitet Raphaela Gromes mit der Musikwissenschaftlerin Susanne Wosnitzka zusammen, die unter anderem für das Archiv Frau und Musik arbeitet und seit über 20 Jahren zu Komponistinnen forscht. Gemeinsam schlagen sie in „Fortissima!“ den Bogen von der persönlichen Geschichte und feministischen Entwicklung der Protagonistin Gromes hin zu den Biografien und Werken der ausgewählten Komponistinnen. Sie erzählen die Geschichten von genialen Frauen wie Hypatia, Sappho und Hildegard von Bingen, von Matilde Capuis, Henriëtte Bosmans und Francesca Caccini, von Louise Farrenc, Marie Jaëll, Ethel Smyth, Amy Beach, Florence Price, Ruth Schonthal und etlichen weiteren. Dabei stellen sie ganz bewusst keinen Anspruch auf Vollständigkeit – legen aber Wert auf einen intersektionalen Ansatz:
Zitat: „Florence Price gilt heute als eines der bekanntesten Beispiele für eine doppelt marginalisierte Komponistin. […] Der Begriff der ‚doppelten Marginalisierung‘ beschreibt die gleichzeitige Diskriminierung aufgrund von zwei oder mehr Identitätsmerkmalen […] Für viele Women of Color bedeutet dies, dass sie sowohl Sexismus als auch Rassismus erleben. […] Diese doppelte Benachteiligung ist nicht einfach die Summe zweier Diskriminierungsformen, sondern sie erzeugt eine eigene, komplexe Realität. […] Die Kämpfe um Gleichberechtigung und Bürgerrechte sind eng mit den Lebensgeschichten vieler Musikerinnen und Komponistinnen verknüpft. Ihre Musik war nicht nur Ausdruck von Kunst, sondern auch ein Werkzeug des Widerstands, der Hoffnung und der kulturellen Identität.“ (216f.)
Gromes und Wosnitzka nehmen auf rund 300 Seiten kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, historische Männer und ihr misogynes und rassistisches Verhalten samt entsprechender Äußerungen anzuprangern. Josef Rheinberger, der aus Prinzip keine Frauen unterrichtete; Robert Schumann, der Clara an den Herd verbannen wollte, und Gustav Mahler, der Alma das Komponieren verbat. Dazu Denker wie Immanuel Kant, Johann Wilhelm Ritter, Arthur Schopenhauer und andere, die Frauen in ihren Schriften systematisch abwerteten. Gromes und Wosnitzka ordnen diese empörenden Tatsachen ein:
Zitat: „Wer die Biografien von Komponistinnen vorstellt, ohne sie in den patriarchalen Kontext der damaligen Zeit zu stellen, verschweigt die wichtigste Lebensrealität und die größte Herausforderung dieser Frauen. Und das passiert leider ständig. Es mag nicht böse gemeint sein, zeigt aber leider, dass auch heute die meisten Menschen noch nicht begriffen haben, was das Patriarchat wirklich bedeutet – und dass es bis heute unser Denken bestimmt.“ (123)
Zum Ausbruch aus diesem Denken gehört besonders, die strikte Trennnung zwischen Mann und Frau infrage zu stellen, die die patriarchale Ordnung überhaupt erst ermöglicht: Hormonspiegel, die Vernetzung der Gehirnhälften, DNA, das alles wiegt am Ende beim Komponieren nicht so schwer wie unsere Lebensumstände und Sozialisation. Im letzten Kapitel versuchen Gromes und Wosnitzka eine Dekonstruktion mit Blick auf die Musik, etwa die Sonatenhauptsatzform. In der Theorie gibt es dort ein Hauptthema und ein Nebenthema, das dem Hauptthema folgt – das eine wird oft als „männlich“, das andere als „weiblich“ bezeichnet:
Zitat: „Die gängige Interpretation der Sonatenhauptsatzform [ist] Ausdruck unserer patriarchalen Kultur. […] Im Grunde sind all diese Zuordnungen vom ‚männlichem starken‘ und ‚weiblichem sanften‘ Thema […] Klischees und Schubladen, die uns nicht weiterbringen. Es ist längst an der Zeit, sich von diesen geschlechtsspezifischen Charaktereigenschaften und Rollenmustern zu verabschieden.“ (285)
„Fortissima!“ ist ein wichtiges, weiteres Buch über Komponistinnen und ihre Lebensrealitäten. Der Text ist nicht nur inhaltlich aufschlussreich und sauber recherchiert, sondern vor allem durch die persönliche Sprechhaltung und zugängliche, kurzweilige Schreibweise packend zu lesen. Dadurch eignet es sich vor allem für Menschen, die neu in den Themenbereich einsteigen wollen – und das passiert hoffentlich mehr und mehr.