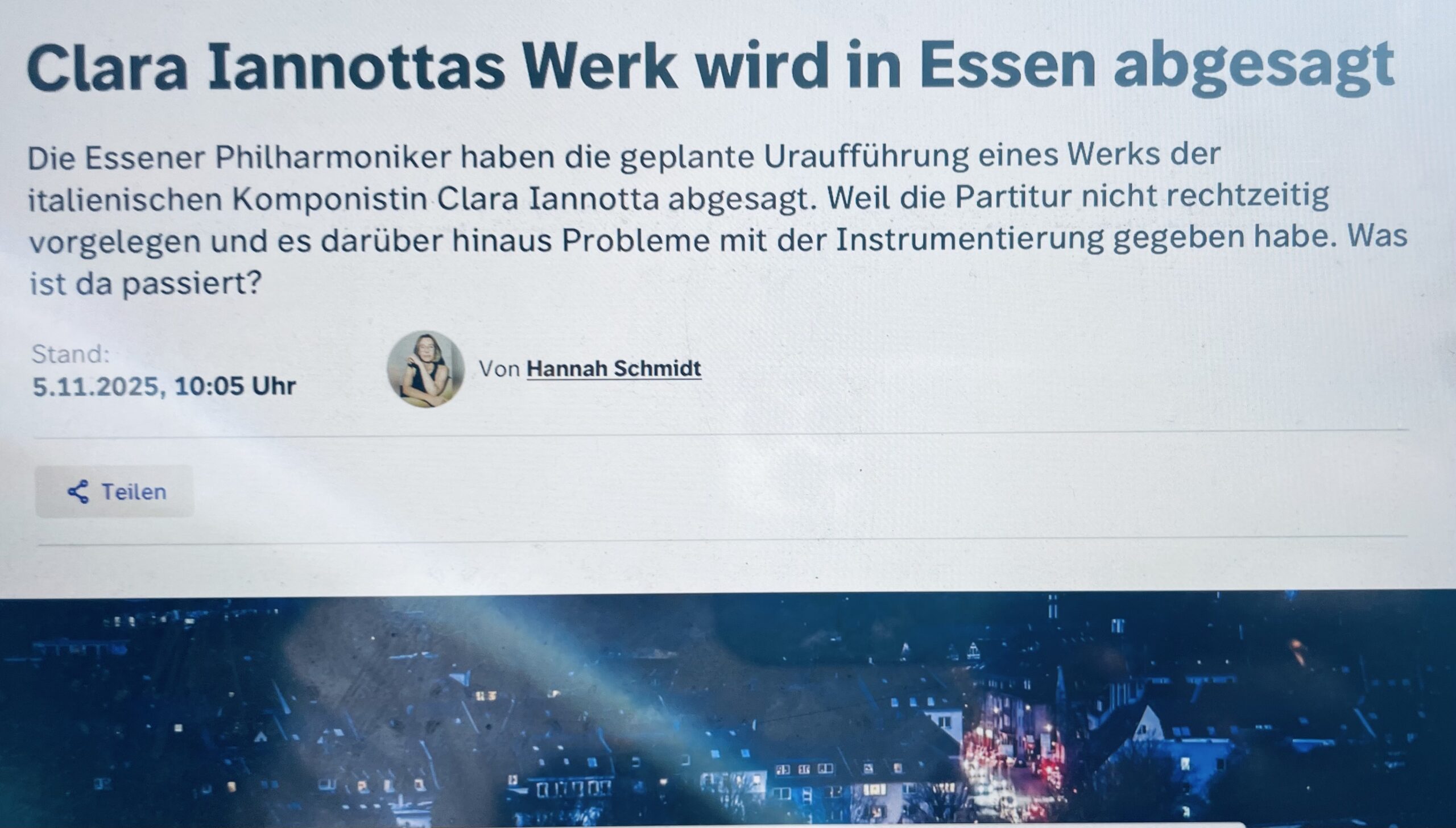Das Management der Essener Philharmoniker hat die geplante Uraufführung eines Werks der italienischen Komponistin Clara Iannotta abgesagt. Weil die Partitur nicht rechtzeitig vorgelegen und es darüber hinaus Probleme mit der Instrumentierung gegeben habe. Was ist da passiert?
Orchester sind traditionell streng hierarchisch organisierte Institutionen, und in dieser Organisationsform verharren sie zumeist statisch. Dazu zählen nicht nur die tradierten Hierarchien von der Intendanz bis runter zum einzelnen Pultplatz auf der Bühne, sondern auch die Arbeitsweise – die ist für Außenstehende kaum in allen Einzelheiten greifbar und komplex aufgespannt zwischen Tarifverträgen, engen Spielplänen und detaillierten musikalischen Interpretationsvorgaben. Die einzelnen Musikerinnen und Musiker haben zumeist nicht viel zu melden, wenn es um die konkrete Ausführung ihres Jobs am Instrument geht – und gar darüber abzustimmen, ob man ein Stück spielt oder nicht, stehe ihnen laut dem Orchestervorstand der Essener Philharmoniker erst recht nicht zu.
In diesem konkreten Fall in Essen war es die Intendantin der Philharmonie, die eine Komposition bei Clara Iannotta in Auftrag gegeben hat – das ist so üblich. Daraufhin hat die Komponistin laut ihren eigenen Ausführungen mit dem Orchestermanagement weiterverhandelt, unter anderem darüber, dass sie zusätzliche klingende Objekte verwenden will – auch das entspricht den üblichen Abläufen. Die Orchestermusikerinnen und -musiker haben dann nach dem Blick in die Partitur gefordert, dass die zusätzlichen Objekte – in diesem Fall kleine Steine, Vogelpfeifen oder Weingläser – als vollwertige Instrumente kategorisiert werden, kurzum: dass sie für das Spielen dieser Instrumente eine finanzielle Zulage bekommen. Außerdem hatten sie in einem konkreten Fall Sorgen um die Unversehrtheit ihrer Instrumente, was bei zeitgenössischer Musik ebenfalls keine Seltenheit ist – diese mehrere Tausend bis Zehntausend Euro teuren Musikinstrumente sind für Berufsmusiker wie Verlängerungen ihres eigenen Körpers. Die Angst, durch eine experimentelle Behandlung etwas kaputt zu machen, ist also real.
Die Musikerinnen und Musiker verhandeln also mit ihrem Arbeitgeber über eine Sondervergütung ihrer Leistung, und die Orchesterleitung erfragt ein Stimmungsbild. Was genau bei dieser Abstimmung herauskam, ist nicht klar – laut Ausführungen des Orchesters hätte ein Großteil gern zugestimmt das Stück wie gehabt zu spielen. Doch das war wohl nicht einstimmig so.In der Folge entschied das Management dann, das Konzert abzusagen. Die offizielle Begründung: Die Partitur sei zu spät eingereicht worden, weshalb eine professionelle Einstudierung nicht möglich gewesen sei.
Solche Absagen passieren immer mal wieder, die Gründe dafür sind unterschiedlich – das allein ist also kein Skandal. Wie es aussieht, geschah diese Entscheidung allerdings ohne Rücksprache mit der Komponistin, der Dirigentin und der Solistin und – nach Angabe des Orchesters – auch über die Köpfe des Orchesters hinweg. Iannotta schreibt, es hätte zum Zeitpunkt der Absage noch die Möglichkeit gegeben, Dinge anzupassen – sie sei zum Beispiel bereit gewesen, bestimmte Objekte wieder komplett aus der Partitur zu streichen, oder dem Orchester Instrumententeile zur Verfügung zu stellen.
Ich habe über diesen Essener Fall mit Thomas Schmidt gesprochen. Er ist Theatermanager und leitender Professor des Studiengangs „Theater- und Orchestermanagement“ an der Musikhochschule in Frankfurt. Er weist darauf hin, dass in diesem Fall der Blick in die Strukturen zentral sei. Man müsse fragen: „Wo innerhalb der Struktur ist der eigentliche Fehler passiert? Ab wann und warum hat sich das Management nicht mehr ausreichend darum bemüht, dass diese Komposition uraufgeführt wird?“ Und nicht zuletzt: „Hat man der Komponistin ausreichend Hilfe und Unterstützung geschenkt?“ Denn eine Sache sticht heraus: Clara Iannotta steht hier als Einzelperson mehreren anonymen Kollektiven gegenüber – und das macht sie angreifbar und verletzlich.
Wir haben es also einerseits zwar in einem sehr alltäglichen Setting mit einer missglückten Einigung über administrative Prozesse zu tun – das kann passieren und ist Teil jeder menschlichen Zusammenarbeit. Andererseits ist nun aber die Frage: War den Musikerinnen und Musikern klar, dass das Management das Konzert absagen würde, wenn sie sich nicht einigen? Dem Statement des Orchesters zufolge war das Orchester von der Entscheidung überrascht. Demnach hat das Management über seine Köpfe hinweg die Entscheidung getroffen und sie in die Öffentlichkeit kommuniziert, mitsamt Anschuldigungen gegen die Komponistin. Hier liegt vielleicht die eigentliche Krux: Dass eine Stelle im Haus das überhaupt tun kann, ist ein strukturelles Problem. Aber zum Glück keines, das nicht reflektiert, bearbeitet und behoben werden könnte. Immerhin hat sich das NOW!-Festival, bei dem das Stück hätte aufgeführt werden sollen, mittlerweile bei Clara Iannotta für die „nicht eindeutige“ Kommunikation entschuldigt. Ob ihr Stück doch irgendwann aufgeführt wird oder nicht, dazu gibt es bisher keine offizielle Information.